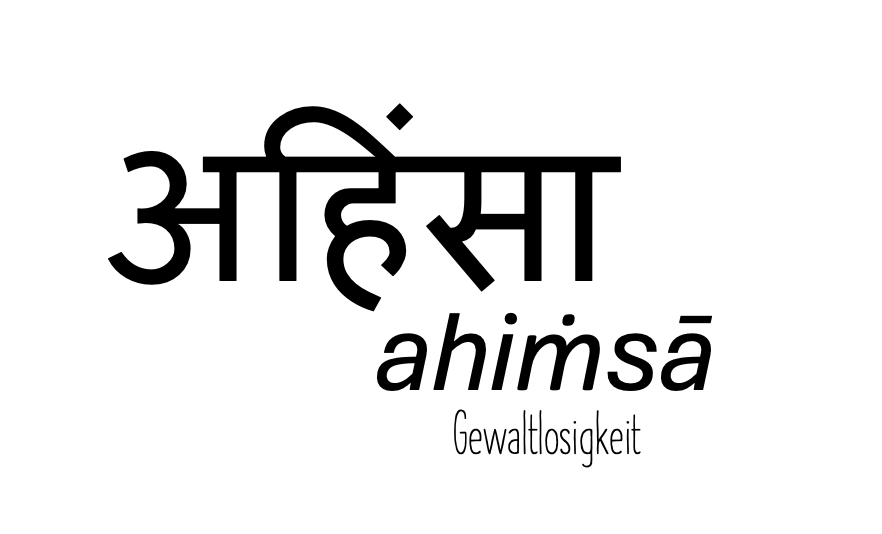Der 12-wöchige Kurs mit dem Leitmotiv Ahimsā ist heute mit einer Bewusstheitsstunde zu Ende gegangen. Hier sind meine Gedanken dazu.
[Um das Konzept von Ahimsā einzuordnen: Das Konzept der Gewaltlosigkeit ist tief in der yogischen Philosophie verwurzelt. Es findet sich in den frühen Schriften des Yoga, wie den Hatha Pradipika, sowie in den Yogasutras von Patañjali, wo Ahimsā als der erste der Yama, der fünf ethischen Prinzipien, aufgelistet wird. Diese Prinzipien bilden den ersten und grundlegenden Schritt der acht Stufen oder Zweige des Yoga. Ahimsā ist auch das ethische Fundament der jainistischen Bewegung, die sich als Gegenpol zur vedantischen Tradition im Indien des 1. Jahrtausends n. Chr. entwickelte. Es bedeutet nicht nur die Abwesenheit von physischer Gewalt, sondern auch die Vermeidung von jeglichem Schaden und die Förderung des Wohlbefindens aller Lebewesen. Ohne Ahimsā können die anderen ethischen Prinzipien wie Satya (Wahrhaftigkeit), Asteya (Nicht-Stehlen), Brahmacharya (Enthaltsamkeit) und Aparigraha (Nicht-Anhaften) nicht vollständig verwirklicht werden und verlieren ihre tiefere spirituelle Bedeutung im Kontext des Yoga.]
Warum Ahimsā?
Mit dem Beginn des neuen Jahres hat das Thema Konflikt meine Gedanken dominiert: Neben der zunehmenden Eskalation und Chronifizierung globaler politischer Konflikte gab es auch persönliche Situationen, in denen ich mich genötigt sah, meine Position zu verteidigen, um nicht das Gefühl zu haben, meine persönliche Freiheit zu verlieren. Dies hat mich dazu veranlasst, mich eingehend mit einem zentralen Konzept der yogischen Philosophie, Ahimsā, zu beschäftigen.
Was ist Ahimsā?
Häufig übersetzt als Nicht-Gewalt, bedeutet A-himsa eher die Abwesenheit (das Präfix „a-“ im Sanskrit deutet auf ein Fehlen hin, eher als eine Negation) von Gewalt oder Nicht-Schaden. Der Begriff „Non-Harm“ im Englischen vermittelt mir am besten das Gefühl dafür. Er bringt das Konzept näher an alltägliche Situationen heran, in denen das Wort Gewalt zu drastisch erscheint. Wenn wir Ahimsā als eine Handlungsweise betrachten, die niemandem Schaden zufügt (einschließlich uns selbst), denke ich, dass es einfacher ist, dies in unserem täglichen Leben umzusetzen.
Wie manifestiert sich Ahimsā in meinem Alltag?
Wie kann ich dieses Konzept zur kontinuierlichen Praxis machen? Denn wie viele, die Yoga praktizieren und unterrichten, fühle ich mich in der aktuellen globalen Situation klein und machtlos. Es entsteht das Bedürfnis, meine Praxis in einen größeren Kontext zu stellen. Denn was ist der Sinn darin, nach innerem Gleichgewicht zu streben in einer Welt, die auseinanderzufallen scheint?
Für mich ist es wichtig, den Teil der yogischen Praxis wiederzuentdecken und zu fördern, der scheinbar weniger mit der körperlichen Übung zu tun hat: die ethischen und Verhaltensprinzipien, Yamas und Nyamas.
Ahimsā auf der Matte
So wurde Ahimsā, der Mittelpunkt meiner Überlegungen, zum zentralen Thema meines letzten Kurses. Welche Herzqualitäten fördern die Entwicklung und Verbreitung einer Kultur der Gewaltlosigkeit? Wie kann ich diese Eigenschaften in meiner Yoga-Praxis und im täglichen Leben zum Ausdruck bringen?
Indem ich Selbstliebe, Empathie, Sanftmut in meinen Reaktionen kultiviere und die Autonomie sowohl meiner selbst als auch anderer fördere, setze ich Altruismus um. Auf diese Weise wechsle ich von der Selbstbeobachtung und -handlung zu einem Fokus auf andere, vom Ich zum Wir. Diese Qualitäten entsprechen verschiedenen Elementen, und jedem dieser Elemente können wir bestimmte Teile und Funktionen des Körpers zuordnen. Im Verlauf des Kurses haben wir uns auf verschiedene Aktivitäten konzentriert, diese geübt und dabei ein Verständnis für die grundlegenden körperlichen Qualitäten entwickelt. Wie kann man beispielsweise Selbstliebe während einer Asana erfahren? Wie kann man Sanftheit und Empathie entwickeln? Wie kann man Autonomie fördern und Altruismus während einer körperlichen Praxis unterstützen?
Natürlich sind die ausgewählten Qualitäten begrenzt und sicherlich eine persönliche Wahl. Für mich war es jedoch wichtig, diesen Übergang vom Individuellen zum Universellen zu umreißen – das Gefühl, dass unsere Zugehörigkeit zu einem Ganzen uns auch für die kleinen Handlungen verantwortlich macht. Es ist ein bisschen wie beim Wählen…
Dieser Prozess hat mir geholfen, die Idee tief zu verinnerlichen, dass Gewaltlosigkeit, das Nicht-Verletzen, im Kleinen beginnt. Gewaltlosigkeit bedeutet nicht passives Akzeptieren… im Gegenteil (es gibt viele großartige Beispiele zivilen Ungehorsams und gewaltfreien Widerstands). Manchmal stellen uns Handlungen und Konflikte vor schwierige Entscheidungen. Was auf den ersten Blick wie ein Meer des Friedens und der Ruhe aussieht – Ahimsā – ist in der täglichen Praxis ein stürmisches Meer, das wir dennoch geduldig navigieren können.
Es gibt verschiedene Bücher und Podcasts, die sich mit der praktischen Anwendung der Yamas und Niyamas sowie dem Konzept von Ahimsā im Alltag befassen. Hier sind einige, die mich auch bei der Auswahl der zu berücksichtigenden Qualitäten inspiriert haben:
- Vanamali Gunturu, Yoga geschichte, Philosophie, Praxis (Ahimsā in der Yoga Stunde)
- Suzan Colón, Yoga Mind (Yama und Nyama im Alltag)
- Eddie Stern, One Simple Thing (Was bedeutet, Ahimsā zu praktizieren – ein Beispil aus dem Leben)
- Jivana Heyman, Yoga Revolution (Yamas und Nyamas im Alltagsleben verkörpern)
- Gandhi and Ahimsā, https://www.mkgandhi.org/articles/Ahimsā-Its-theory-and-practice-in-Gandhism.php
- Let’s talk yoga Podcast, Contextualising Ahimssa and making it relatable in Yoga Classes: